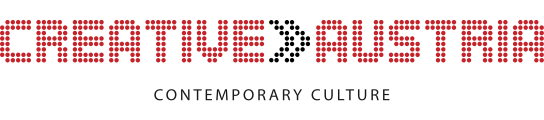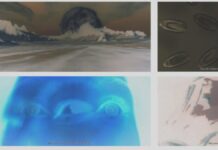Ein offener Diskurs über Kultur, Stadt und Lebensraum.
Graz Kulturjahr 2020: Kultur als Trigger für sozialen Diskurs.
Wie wollen wir leben – wenn wir in einer absehbaren Zukunft wieder so leben dürf(t)en wie wir wollen? Was hat sich durch die Pandemie bereits geändert? Und was würden wir ändern? Auch im Kulturbereich.
Wenige Tage nachdem die ersten Lockdowns in Europa verhängt worden sind, haben bereits die ersten Zukunftsforscher in einem Wettlauf um die Zukunftsthemenführerschaft ihre Prognosen und Prospektiven für die Zeit nach der Pandemie auf den Markt geworfen. Matthias Horx hat uns im März 2020 bereits für den Herbst desselben Jahres vorhergesagt, wie „Die Welt nach Corona“ aussehen werde: Wir würden Langzeittelefonate ohne Second Screens zu lieben begonnen haben. Wieder „wirklich“ miteinander kommunizieren. Man wäre so höflich, niemanden mehr mit der Beantwortung von Mails warten zu lassen und überhaupt jederzeit gerne ohne vorgeschalteten „Anrufbeantworter“ erreichbar. Bücher lesen wäre wieder zum Kult geworden und Political- Correctness-Diskurse passé. Die Menschen würden sich solidarisch und konstruktiv verhalten. Wir würden staunen über das Ausmaß an Humor und Mitmenschlichkeit, dass uns das Virus im Umgang miteinander gebracht hätte. Die Börsenwerte hätten sich zwar halbiert, aber das wäre egal, weil gute Nachbarschaft und Gemüsegärten wieder wichtiger geworden wären.
Die Zunft der Zukunftsforscher wie Horx verpackt ihre Vorhersagen gerne in gut vermarktbare, knackig klingende Labels: „RE-Gnose: Gegenwartsbewältigung durch Zukunfts-Sprung“, „Future-Mind-Zukunfts- Bewusstheit“. Das zieht bei Konzernvorständen, Venture-Capital-Investoren oder gut finanzierten Think-Tank-Managern, die das nächste Salon-Programm ihrer Lobbygroup mit Veranstaltungsterminen vor den daran anschließenden Zigarrenrunden füllen müssen. Ob Ernsthaft oder Schabernack kehren wir besser in die Gegenwart des Frühjahres 2021 zurück und versuchen eine Bestandsaufnahme.
Die grundlegenden Parameter sind bekannt:
Global betrachtet: Das Klima heizt sich auf. Die Ressourcen werden knapp. Wirtschaftswachstum geht nicht unendlich. Die Bevölkerung wird in den Industrienationen immer älter. Anderswo nicht. Artificial Intelligence stellt den Arbeitsmarkt auf den Kopf und Vollbeschäftigung war 20. Jahrhundert. Die digitale Überwachung wird immer lückenloser, das Konzept der bürgerlichen Grundfreiheiten und die Idee der liberalen parlamentarischen Demokratie sind in der Defensive. Die Menschenrechte sowieso. Der Gini-Index steigt. Weltweit.
Lokal: Der oligopolartige Onlinehandel räumt die Erdgeschosszonen der Innenstädte leer. Und die hässlichen Blechbüchsen der Einkaufszentren in den Vorortwüsten gleich mit dazu. Im 20. Jahrhundert wurde der Lebensraum dem Auto angepasst und die solcherart zersiedelt-verschandelte Landschaft verursacht Augenbluten. 80 cm Gehsteigbreite blieben für die Menschen. Und ihre Haustiere. Die multikulturell geprägten Städte befinden sich in vielschichtigen gesellschaftspolitischen Kulturkämpfen auf denen Populisten wie auf einer Welle surfen und diese so noch weiter anheizen. Das Bildungssystem der Städte erreicht die jungen Menschen dieser fragmentierten Gesellschaft nicht mehr richtig und bringt massenweise bildungsbenachteiligte Jugendliche hervor.
„Kunst und Kultur werden in den kommenden Jahren einen Riesenbeitrag für die Gesellschaft leisten können. Mehr, als das ohne die Pandemie möglich gewesen wäre.“
Margarethe Makovec, Kunstverein <rotor>
Und: Wir schauen einander nicht mehr in die Augen. Sondern ins Smartphone oder Tablet. Wie also wollen wir leben? So nicht. Statt aber Zukunftsforschern oder Propheten die indikative Feststellung einer wünschenswerten Zukunft zu überlassen, der wir aus der Gegenwart heraus nur mehr nachzulaufen bräuchten, ist man in Graz im Rahmen des Kulturjahres 2020 einen anderen Weg gegangen: Man hat gefragt. Nicht Zukunftsforscher, Statistiker oder Investoren. Sondern KünstlerInnen, Kulturschaffende, Kreative und GeisteswissenschaftlerInnen.
„Wie wir leben wollen?“, war der Titel des Programmcalls für das Graz Kulturjahr 2020, das jetzt wegen der Corona Lockdowns ins Jahr 2021 verlängert worden ist.
Gefragt wurde nach Reflexionen, Betrachtungen, Entwürfen und Ideen zur Zukunft der Städte und der Menschen, die in ihnen leben. Nach lokalen Gestaltungsmöglichkeiten, eingebettet in den Rahmen ihrer globalen Bedingungen. Nach den großen Themen in der lokalen Wirklichkeit: Soziales Zusammenleben, Digitalisierung, Klimawandel: Wie wollen wir leben und was können wir tun?
Welche Rolle können Kunst und Kultur bei Krisenbewältigungen spielen?
„Kunst wurde von Vielen oft als etwas Elitäres am Rande der Gesellschaft wahrgenommen. Heute sprechen wir viel öfter als früher von künstlerischen Ideen die zu sozialen Ideen werden“, sagt Christian Mayer, Programm-Manager des „Graz Kulturjahr 2020“.
Die für das Programm ausgewählten Projekte formulieren keine Prognosen, sondern bieten Ideen, Perspektiven, Kritik und Handlungsanregungen an. Margarete Makovec und Anton Lederer vom Grazer Kunstverein <rotor> engagieren sich mit ihren Kunst-Projekten schon seit vielen Jahren in einem Interaktionsbereich zwischen Kunst, öffentlichem Raum und sozialen Diskurs. Für das Graz Kulturjahr 2020 haben sie unter anderem das Projekt „Schule des Wir“ konzipiert.
„Künstlerinnen und Künstler erkennen oft Dinge und Zusammenhänge, die noch latent und nicht unmittelbar sichtbar sind. Sie übernehmen häufig die Rolle eines Seismographen. Formulieren einen erweiterten Denkraum und auch Kritik. Das versuchen wir bei vielen Projekten die wir machen auch in den uns unmittelbar umgeben- den öffentlichen Raum hinein zu tragen. Denn dann wird Kunst erst richtig interessant. Wenn es auch gelingt unmittelbar und lokal eine direkte Involvierung der Menschen zu erzeugen.“, sagt Margarete Makovec. „Graz hat ein hohes Bildungsniveau. Es gibt viele Kunst- und Kulturinteressierte. Durch den Schritt in den öffentlichen Raum erzeugen wir Involvierung und öffentlichen Diskurs. Das ist gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft in immer isolierter werdende soziale Blasen zerfällt unheimlich wichtig. Und in multikulturell geprägten Vierteln wie im Grazer Lend oder Gries steckt da ein ganz besonderes Potenzial.“
Von der Kulturpolitik ausgelobte Themencalls mit gezielten thematischen Fragen laufen natürlich immer auch Gefahr, dass sie von den KünstlerInnen als politischer Instrumentalisierungsversuch empfunden werden. Dessen ist sich auch der Grazer Kulturstadt Günter Riegler bewusst: „Einen Auftrag zu erteilen wird nicht funktionieren. Aber wir können uns an Künstlerinnen und Künstler mit Fragestellungen wenden. Das war auch der Gedankenansatz für den Call des Graz Kulturjahr 2020. Wir haben Fragen gestellt zu den großen Zukunftsthemen: Klimawandel. Digitalisierung. Neue Arbeitswelten. Wir haben dazu eingeladen, mit den Mitteln der Kunst für uns nach vorne zu blicken. Und nicht in erster Linie zurück. Kunst und Kultur kann uns neue Perspektiven eröffnen, aber mir ist als Kulturpolitiker durchaus bewusst, dass man Kunst nicht instrumentalisieren kann.“
Die Politik bekam auch gleich einmal den Spiegel vorgehalten: 7.000 Pfeffersprays wollte die Neigungsgruppe K.O. mit Johanna Hierzegger, Markus Wilfling und Martin Behr in der Bevölkerung verteilen um damit die Frage zu verknüpfen: „Wieviel Sicherheit verträgt die Stadt?“. Als Plakatdestimonial für das Projekt hatten sich die Schauspielerin Pia Hierzegger und Ex-Caritas Direktor Franz Küberl zur Verfügung gestellt. Der damit verbundene gesellschaftspolitische Diskurs über das Schüren von Ängsten, der durch diese erzeugten Ängste gerechtfertigten Überwachung und den damit verbundenen sukzessive immer mehr erweiterten Einschränkungen der bürgerlichen Grundfreiheiten und der Privatsphäre wurde aber durch den Ausbruch der Pandemie jäh verkehrt. Nicht die in den vergangenen Jahren hauptsächlich von Populisten vorangetriebene demokratiebe- schränkende Dimension der Sicherheitsdebatte stand nun im Mittel- punkt, sondern die Rücksichtnahme auf die Gesundheit der Nächsten. Die „Neigungsgruppe K.O.“ hat ihr Projekt deshalb komplett umkonzipiert: Aus 7.000 Pfeffersprays wurden 5.000 Desinfektionssprays. Das KünstlerInnenkollektiv hat sich in „Neigungsgruppe O.K.“ umbenannt.
Gleichzeitig stellen sich heute jene, die noch vor kurzer Zeit das Überwachungspaket durch das Parlament geboxt haben um dann damit vor dem Verfassungsgerichtshof zu scheitern, an die Spitze der Demonstrationen jenes Amalgams aus Corona-Irrationalisten, das in den Pandemiebekämpfungsmaßnahmen ausschließlich die Dimension einer Grundrechteeinschränkung sieht. Dass der zum Thema Sicherheit und bürgerliche Freiheiten notwendige Diskurs längst nicht in einer notwendig sachlichen und ausdifferenzierten Form geführt ist, macht dieser Rollentausch und die skandierende Dialogunfähigkeit, mit der sich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen dabei gegenüberstehen, besonders deutlich.
Kunstprojekte wie „5.000 Desinfektionssprays für Graz“ bieten in diesem aufgeheizten Klima ein „Nudging“ für einen dringend nötigen Diskurs in der Bevölkerung, bei dem man einander vielleicht auch wieder einmal zuhört.
Dieses verstärkte Eingreifen von Kunst und Kultur in den gesellschaftspolitischen Diskurs ist zwar kein neues Phänomen. Aber es hat durch Smartphones, Streamingangebote, Soziale Medien und der damit verbundenen Erosion sozialer Begegnungen in der realen Welt neue Rollen und Aufgaben erhalten.
Christian Mayer sieht in diesem Kontext auch neue Aufgabenstellungen für etablierte Kultreinrichtungen wie beispielsweise Museen: „Ganz generell hat sich die Wahrnehmung von Kunst und künstlerischen Dingen in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Kunst hat nicht mehr so stark den Geruch des „elfenbeinartigen“ sondern ist viel mehr zum Anfassen. Das sieht man auch im Museumsbereich, in dem uns vor allem England viel vorgemacht und vorgelebt hat: Museen und die Kunst die dort präsentiert wird sind nicht in sich abgeschlossen. Die öffentlichen Museen sind weitestgehend frei – also auch bei freiem Eintritt – zugänglich und so auch viel mehr Teil des Alltags der Menschen. Gleichzeitig beobachtet man auch eine Erweiterung des Kunstbegriffes immer stärker hin zur gesellschaftspolitischen Rolle der Kunst. Das setzt sich im Bereich der Kunstvermittlung fort, in der KuratorInnen und Vermittlungsteams immer stärker in einem transdisziplinären Kontext denken und arbeiten. Das heißt, wir können hier einen sich wechselseitig beeinflussenden Veränderungsprozess beobachten, der sowohl von einem Wandel des Verhältnisses der Gesellschaft zum Kunstbetrieb als auch umgekehrt von einem Wandel des Kunstbetriebes selbst mit einer verstärkten Zuwendung zu gesellschaftspolitischen Fragen vorangetrieben wird. Dabei lösen sich durch die Digitalisierung auch alte Grenzen zwischen unterschiedlichen Sektoren mit großer Geschwindigkeit auf. Wir können uns heute zu jeder Zeit online mit allen The- men beschäftigen, die uns interessieren. Netflix etc. sind rund um die Uhr verfügbar. Warum soll ich mich also beispielsweise mit beschränkten Öffnungszeiten heimischer Museen herumschlagen, wenn mir das, was mich interessiert anderswo auch um 22.00, 23.00 Uhr – wenn ich eben gerade Zeit und Lust dazu habe, geboten wird. Auch der inklusive Zugang zu Kultur ist noch eine große Aufgabe der kommenden Jahre.“, sagt Mayer.
„Kunst wurde bisher oft als etwas Elitäres betrachtet. Heute sprechen wir viel öfter von künstlerischen Ideen, die zu sozialen Ideen werden.“
Christian Mayer, Graz Kulturjahr 2020
Es ist aber nicht nur eine Frage der Neugestaltung des Zugangs zu Kunst und Kultur und des Abbaus der noch vorhandenen Barrieren, die zum Gebot der Stunde für alle Kultureinrichtungen geworden sind, wenn sie gegen Ende der Pandemie schrittweise wieder ihre Tore öffnen können. Es gilt auch genau hinzusehen, welchen stillen und unsichtbaren Erosionsprozess die Pandemie im kulturellen Gefüge einer Stadt bereits jetzt verursacht hat und wie man am Besten darauf reagieren sollte.
„Wenn eine Musikerin ein Jahr ohne Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten ist, dann muss sie sich nach etwas anderem umschauen um überleben zu können“ sieht Margarete Makovec die aktuelle Situation realistisch. „Aber die Frage ist doch: Was verliert eine Stadt, wenn ihr KünstlerInnen und Kreative auf diesem Weg verloren gehen?“
Ein Problem, das man inzwischen auch in der Politik erkannt hat. „Wir sehen durch die Krise jetzt schon Veränderungen in der Kulturszene. KünstlerInnen, die in der Vergangenheit schon prekär gelebt haben, machen jetzt zum Beispiel Ausbildungen als Pflegerin. Die Pandemie verändert also jetzt schon das kulturelle Gefüge der Stadt. Und die Frage ist, soll man diese Veränderungen einfach geschehen lassen oder soll man steuernd eingreifen?“, fragt der Grazer Kulturstadt Günter Riegler.
Viele Künstlerinnen und Kreative sind heute in breit gefächerten Handlungsfeldern zwischen Kunst, angewandter Kunst und gesellschafts- und sozialkritischen Aktionsfeldern mit einem oft multiplen Rollenverständnis aktiv. Nicht nur deshalb, weil sie sich selbst damit bessere Möglichkeiten schaffen, den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können, sondern oft vor allem auch deshalb, weil sich in diesen heute fluiden Transferzonen zwischen Kunst, Kultur, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft auch die Themen und Anliegen, mit denen sie sich beschäftigen wirkungsvoller bearbeiten lassen. Die Debatte um die Freiheit der Kunst und ihre Abgrenzung von anwendungsorientierten Formen künstlerisch-kreativen Arbeitens hat insbesondere durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche neue Dimensionen hinzu gewonnen.
Für Wolfgang Skerget, den Leiter des Büros Graz – UNESCO City of Design ist es gerade in diesem Kontext auch wichtig, dass eine Stadt Strukturen bietet, die immer auch genügend zweckfreien Frei- Experimentierraum offen lässt. Skerget verweist in diesem Kontext auf Joseph Beuys, der heuer 100 Jahre alte geworden wäre: „Er hat schon vor Jahrzehnten viele Entwicklungen skizziert, die heute – insbesondere durch die Sozialen Medien – eine allgemeine Präsenz erlangt haben. Seine Fluxus Aktionen haben viel von dem vorweg genommen, was wir heute täglich auf allen sozialen Kanälen tausendfach sehen können. Kunst hatte immer auch die Rolle, Entwicklungen frühzeitig seismografisch zu erkennen und zur Debatte zu stellen“ betont Skerget. „Ich finde es deshalb in diesem Kontext spannend und wichtig, die Verbindung zwischen Kunst und Kultur einerseits und den eher anwendungsorientieren Bereichen des Designs andererseits kontinuierlich auszubauen und zu stärken. Wenn wir unsere Umwelt, unseren Alltag und unser Zusammenleben konstruktiv gestalten – also „designen“ – wollen, dann braucht es zuerst immer auch Visionäre, Künstlerinnen und Künstler, die voraus schauen, experimentieren und untersuchen, ohne schon dem Diktat des Zwecks und der Nutzbarkeit unterworfen zu sein. Die Kunst kann so ein Treiber sein, die Dynamiken auslöst, die von anderen gestaltend weiter getragen werden.“
Der gerade der durch die Digitalisierung der Gesellschaft vorangetriebene Verlust realer Sozialkontakte in der physischen Welt hat durch die Coronakrise eine weitere Dynamisierung erfahren. Christian Mayer sieht darin ein großes Chancenpotenzial für den Kulturbereich: „Sowohl die Digitalisierung als auch die Coronakrise rücken in diesem Kontext wieder einen Aspekt in den Vordergrund, der aus meiner Sicht insbesondere für KünstlerInnen, Kulturschaffende und auch Museen neue Chancenpotenziale öffnet. Nämlich der Aspekt des für den jeweiligen Ort und für das jeweilige Haus Spezifischen. Vor Corona hat man ja massenweise „Weltkunst“ durch die Gegend geschippert und in Form von zusammengetragenen Blockbusterausstellungen als Tourismusmagnet aufgestellt. In den letzten Monaten hat das coronabedingt nicht mehr funktioniert.
„Die Pandemie verändert das kulturelle Gefüge der Stadt. Und die Frage ist,
soll man diese Veränderungen einfach geschehen lassen oder soll man steuernd eingreifen?“
Günter Riegler, Kulturstadtrat Graz
Da haben die Kuratoren dann angefangen wieder genauer in die eigenen Sammlungsbestände zu schauen und waren teilweise ganz überrascht, welche Schätze da zu heben sind. Und ich denke mir – ganz grundsätzlich: Vielleicht ist das das Gebot der Stunde. Auch nachhaltig gedacht. Dass wir mit unseren Kulturkonzepten zunächst aus unseren lokalen Rahmenbedingungen heraus arbeiten und so zum Einen den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort Schaffensräume ermöglichen und zum Anderen den Menschen Kultur als reales Erlebnis sichern. Dinge machen, die man hier und nur hier physisch ansehen und vor Ort erleben kann. Für die es einen tatsächlichen Grund für das Hier und Jetzt gibt. Denn wir leben ja heute in dem Bewusstsein, dass wir uns alles von überall her zu jeder beliebigen Zeit digital auf unser Handy holen können. Und gerade deshalb hat das auch keine wirkliche Bedeutung mehr für uns.“
Mayer ist deshalb überzeugt: „Die Zukunft der Kultur gehört wohl wieder den realen Dingen im echten Leben.
Graz Kulturjahr 2020
Graz Inklusiv
Neue, inklusive Ideen für das Grazer Kulturprogramm
20.08.2020 – 28.05.2021
Various locations
kulturjahr2020.at/projekte/kulturinklusiv
Der Grazer Kunstverein zieht um
Stadt-und Standortforschung quer durch Graz
2020/2021
Various locations
kulturjahr2020.at/projekte/der-grazer-kunstverein-zieht-um
Graz Backstage
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Infrastruktur
Various locations
20.12.2020 – Oktober 2021
kultujahr2020.at/projekte/graz-backstage
Aus dem Schatten des Wasserturms
Durch Interventionen, Altes Zuhause, neu kennenlernen
20.03.2020 – Juli 2021
Various locations
kulturjahr2020.at/projekte/aus-dem-schatten-des-wasserturms
Klima-Kultur-Pavillon
Frischluftoase, mitten in der Stadt
28.04. – 15.08.2021
Freiheitsplatz
kulturjahr2020.at/projekte/klima-kultur-pavillon
Re_start_#Graz2020
Kunst als interkultureller Brückenbauer
29.04. – 20.06.2021
Verein Jukus
Jukus.at/restart
wORTwechsel
Orte der Stadt werden auf literarische Weise erkundet
22.04. – 24.06.2021
Various locations
kulturjahr2020.at/projekte/wortwechsel
transletter
Drei Redaktionsteams bringen vielsprachige Sonderausgabe im Zeitungsformat heraus
Juli 2021
Schlossberg
kulturjahr2020.at/projekte/transletter
Utopia Square
Nachhaltige Entwicklungsziele als Performance
14.06. – 30.06.2021
kulturjahr2020.at/projekte/utopia-square
Classroom on stage
Persönlichkeitsentwicklung im Digi Lab
08.06. – 02.07.2021
Mittelschule St. Leonhard
kulturjahr2020.at/projekte/future-classroom-on-stage
Alle Informationen unter kulturjahr2020.at